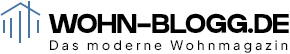Die hohen Strompreise haben der alternativen Energieerzeugung in den letzten Jahren einen kräftigen Schub gegeben. Besonders gefragt sind neben den klassischen Photovoltaikanlagen (kurz: PV-Anlagen) derzeit sogenannte Balkonkraftwerke.
Hierbei handelt es sich um Mini-Photovoltaikanlagen, die nicht auf dem Dach, sondern einfach außen auf dem Balkon angebracht oder aufgestellt werden. Ein kleiner Wechselrichter wandelt den vom Balkonkraftwerk erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um und speist ihn in das Wohnungsnetz ein.
Doch kann das Balkonkraftwerk eine PV-Anlage ersetzen? Und welches System lohnt sich unter welchen Voraussetzungen eher? Wir klären auf.
Zielgruppe und Einsatzbereiche
Auf den ersten Blick scheinen die Zielgruppen und Einsatzbereiche von Balkonkraftwerken und PV-Anlagen (die meist auf dem Dach installiert werden) gleich zu sein: Jeder Haus- oder Wohnungsbesitzer, der sich unabhängiger von der teuren Energie der bekannten Versorger machen möchte.
Doch die Unterschiede werden bei genauerer Betrachtung sichtbar. So eignen sich Balkonkraftwerke zum Beispiel auch für Mieter, die ansonsten keine Möglichkeit hätten, eine PV-Anlage zu installieren, da ihnen das bewohnte Gebäude bzw. die Mietwohnung nicht gehört.
Größe, Leistung und Energieerzeugung
Der Erfolg solcher Minikraftwerke liegt vor allem darin begründet, dass sie von jedermann völlig unbürokratisch in Betrieb genommen werden können und dann ihren Beitrag zum Umweltschutz und zur Senkung der Energiekosten leisten.
Es müssen nur einige Grundvoraussetzungen erfüllt werden. So darf ein Balkonkraftwerk in Deutschland bis zu 600 Wp liefern. Das hört sich nicht viel an – jeder Toaster braucht mehr Leistung. In der Summe können die Minikraftwerke aber tagsüber die Grundlast eines durchschnittlichen Haushalts abdecken und zum Beispiel die Energieversorgung eines Home-Office übernehmen.
Wichtig zu wissen: Ein Balkonkraftwerk braucht hierzulande keine Sondergenehmigung, der Netzbetreiber muss lediglich zwei Wochen vor Inbetriebnahme informiert werden. Als weitere Bedingung muss jedoch ein fester Anschluss an das Netz vorhanden sein. Dazu reicht eine gewöhnliche Schuko-Steckdose auf dem Balkon aus.
Die Leistung einer herkömmlichen Photovoltaikanlage, die üblicherweise in Form einzelner Module auf dem Hausdach installiert wird, hängt von Größe, Modultyp und Standort ab. Ein typisches Solarmodul liefert etwa 300 bis 400 Watt, so dass eine durchschnittliche Anlage auf einem Einfamilienhaus eine Gesamtleistung von 5 bis 10 kWp erreicht. In Deutschland erzeugt eine solche Anlage pro kWp etwa 900 bis 1.200 kWh Strom pro Jahr, dies entspricht bei einer 5-kWp-Anlage einem Jahresertrag von 4.500 bis 6.000 kWh.
Wichtig zu wissen: Dies sind nur Durchschnittswerte – Faktoren wie geografische Lage, Ausrichtung und Neigung der Module sowie der Verschattungsgrad beeinflussen den Ertrag erheblich.
Vorteile des Balkonkraftwerks
Ein Balkonkraftwerk benötigt nicht viel Platz und ist flexibel einsetzbar. Die Paneele eignen sich für praktisch jedes Haus oder jede Wohnung mit einem Balkon – vorzugsweise natürlich auf der Südseite. Aber auch auf der Nordseite können die Paneele zur Not eingesetzt werden, allerdings liefert das Balkonkraftwerk dann nur gut die Hälfte des Stroms.
Tipp: Um die Energieausbeute zu optimieren, kann die Fläche der Fotozellen vergrößert werden. Die 600-Wp-Grenze gilt nämlich nur für die Leistung des Wechselrichters, nicht aber für die Panels.
Aber auch wenn es prinzipiell erlaubt ist, die Paneele zu installieren, sollte vorher der Vermieter oder Miteigentümer konsultiert werden. Viele Vermieter haben Bedenken wegen des Aussehens oder einer Beschädigung der Bausubstanz. Durch ein Vorabgespräch, u. U. mit Vorführung der Technik vor Ort, lassen sich diese Vorurteile in der Regel schnell ausräumen.
Über die Vorteile einer klassischen PV-Anlage auf dem Dach müssen wir hier nicht mehr viele Worte verlieren. Sie bietet ein Vielfaches der Leistung eines Balkonkraftwerks und kann – zumindest in den Sommermonaten – den kompletten Haushalt mit Energie versorgen, sofern sie ausreichend dimensioniert ist.
Installation und Genehmigungsaufwand
Balkonkraftwerke bestehen in der Regel aus ein- bis zwei Solarmodulen, deren erzeugter Strom über eine Steckdose ins Hausnetz eingespeist werden kann. Der Installationsaufwand ist gering, da keine aufwändige Verkabelung oder ein separater Wechselrichter notwendig ist.
Eine klassische Dachanlage hingegen hat eine deutlich höhere Leistung von 5 bis 10 kWp und erfordert professionelle Planung und Installation. Die Montage der Module, das Verlegen der Kabel, der Anschluss des Wechselrichters und ggf. die Integration eines Stromspeichers müssen von einem Profi vorgenommen werden.
Das Balkonkraftwerk dagegen kann auch von einem Laien installiert und in Betrieb genommen werden, es eignet sich somit ideal für Mieter oder kleinere Haushalte. Auch der Genehmigungsaufwand fällt hier fast komplett weg. Für eine Dachanlage müssen stattdessen Genehmigungen eingeholt werden, dafür bietet sie die Möglichkeit, über den eigenen Strombedarf hinaus produzierte Überschüsse ins öffentliche Netz einzuspeisen.
Kosten und Wirtschaftlichkeit
Die klassische PV-Anlage auf dem Dach amortisiert sich üblicherweise erst nach etlichen Jahren, die Anschaffung ist vergleichsweise teuer. Auch der Wartungsaufwand ist deutlich höher als bei einem technisch viel einfacher aufgebautem Balkonkraftwerk. Daher lohnt sich die PV-Anlage eher bei einem Neubau oder im Rahmen der energetischen Sanierung eines bestehenden Gebäudes.
Fazit
Der Vergleich zwischen einem Balkonkraftwerk und einer herkömmlichen PV-Anlage zeigt, dass sich die Modelle an unterschiedliche Zielgruppen richten und jeweils eigene Vor- und Nachteile aufweisen. Für größere Haushalte mit eigener Immobilie oder einer Eigentumswohnung bietet sich im Rahmen des Kaufs oder einer Sanierung die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach an, kleiner Haushalte in Mietwohnungen dagegen können mit einem Balkonkraftwerk zumindest einen (kleinen) Teil der Energiekosten decken.